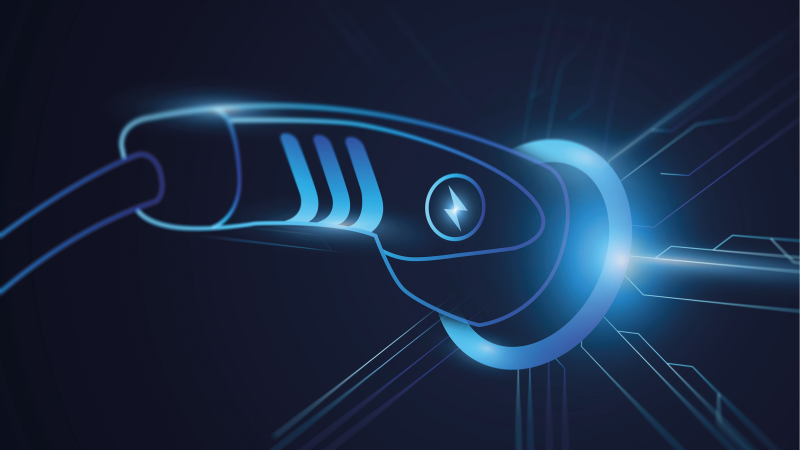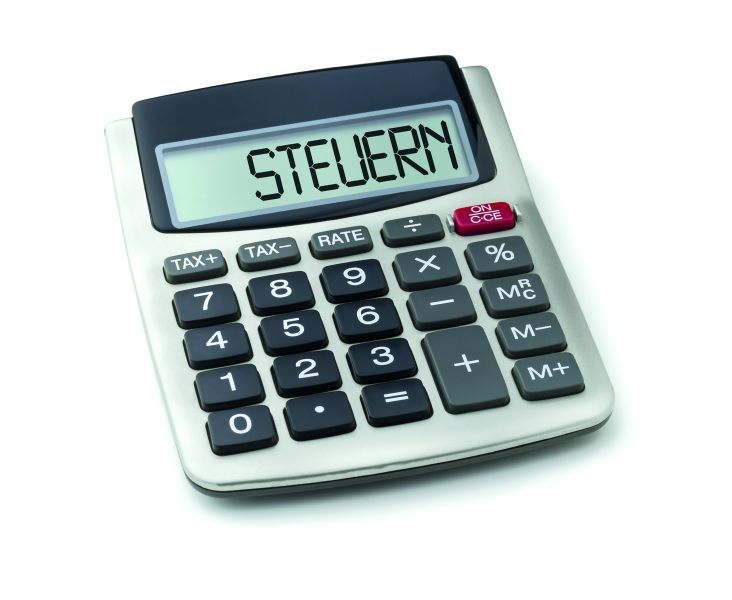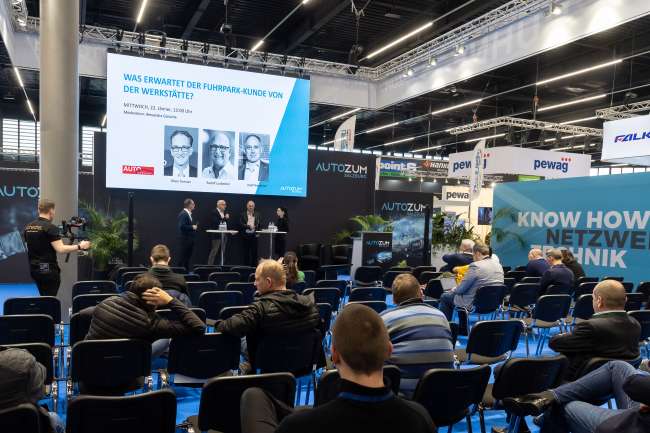Nach langer Ungewissheit aufgrund der unterschiedlichen Regierungsverhandlungen gibt es nun – zumindest für heuer – Sicherheit, was die Auto-Besteuerung betrifft. Im Wesentlichen geht es um zwei Änderungen. Zum einen fällt mit 1. Juli die NoVA-Pflicht auf Nutzfahrzeuge (Details auf Seite 12 dieser Ausgabe), die zweite Änderung betrifft die Einführung (bzw. das Ende der Befreiung) der motorbezogenen Versicherungssteuer bei Elektroautos sowie die Erhöhung selbiger bei Plug-in-Hybriden ab 1. April.
Wie wir auf der nächsten Doppelseite zeigen, kommen E-Fahrzeuge kostenmäßig deutlich besser weg als Verbrenner, das liegt an der Berechnungsmethode und auch an der Besonderheit in der Leistungsangabe bei batterieelektrischen Fahrzeugen. Hier wird zwischen einer Dauerleistung (30-Minuten-Leistung), die im Zulassungsschein eingetragen wird, sowie einer Spitzenleistung unterschieden, die dem Fahrer kurzzeitig zur Verfügung steht. Lokale CO2-Emissionen gibt es beim Elektroauto naturgemäß nicht, es kommt allerdings noch eine Gewichts-Komponente dazu, die Größe und Gewicht eines E-Autos beim Käufer sensibilisieren sollen.
Komplexe Berechnung
Kommen wir zur Berechnung: Von der eingetragenen Dauerleistung werden 45 kW abgezogen. Für die verbleibende Leistung gelten gestaffelte Sätze:
• Für die ersten 35 kW: 0,25 EUR pro kW
• Für die nächsten 25 kW: 0,35 EUR pro kW
• Für jedes weitere kW: 0,45 EUR pro kW
Dabei muss zumindest ein Wert von 10 kW angesetzt werden.
Zweite Komponente Gewicht
Von dem im Zulassungsschein eingetragenen Eigengewicht werden 900 kg abgezogen. Auf den Differenzwert werden ebenfalls gestaffelte Sätze angewandt:
• Für die ersten 500 kg: 0,015 EUR pro kg
• Für die nächsten 700 kg: 0,03 EUR pro kg
• Für jedes weitere kg: 0,045 EUR pro kg
Hier ist mindestens ein Wert von 200 kg zu berücksichtigen.
Die Ergebnisse von Leistung und Gewicht werden addiert und ergeben die monatlich fällige motorbezogene Versicherungssteuer. Der Wert wird für die jährliche Zahlungsweise addiert, bei anderen Zahlungsintervallen fallen die üblichen Zuschläge an.
Plug-in-Hybride zahlen mehr Steuer
Bei Plug-in-Hybriden (die nach dem 30. September 2020 zugelassen werden) bleibt grundsätzlich die bisherige Berechnungsmethode erhalten – also die Berechnung der Steuer auf Basis der Motorleistung (des Verbrennungsmotors) und der CO2-Emissionen. Jener Abzugsbetrag, der bisher zur Minderung der Steuerlast festgelegt war, wird allerdings angepasst.
Der – zuvor höhere – Abzug für den CO2-Wert bei Plug-in-Hybriden wird reduziert. Dadurch führt die Berechnung zu einem höheren Steuerbetrag, Plug-in-Hybride werden dadurch künftig im Durchschnitt stärker besteuert als unter den bisherigen Regelungen.
Die Steuer bemisst sich dabei folgendermaßen: Pro kW des Verbrennungsmotors sowie für jedes Gramm CO2, das den festgelegten Abzugswert übersteigt, wird eine monatliche Abgabe von je 0,72 Euro erhoben (mindestens 5 kW bzw. 5 Gramm CO2). Für Fahrzeuge, die nach dem 30. September 2020 erstmalig zugelassen wurden bzw. zugelassen werden, gelten ab dann – abhängig vom Jahr der Erstzulassung (EZ) – die in der Tabelle -angegebenen Abzugswerte.
Für herkömmliche Pkw-Verbrenner und -Hybride ohne externe Aufladung ändert sich an der Regelung nichts. Allerdings wurde die bereits bestehende jährliche Erhöhung der Steuer für neuzugelassene Pkws rechtlich bestätigt.
Steuer auch für E-Motorräder und Wohnmobile
Die Einführung der motorbezogenen Versicherungssteuer betrifft auch elektrische Zweiräder. Hier fallen 0,50 EUR je Kilowatt (der um 5 Kilowatt verringerten) Leistung an, wobei aber mindestens 4 Kilowatt anzusetzen sind.
Nicht zuletzt gibt es für Wohnmobile Änderungen. Für elektrische Wohnmobile wurde die Steuer neu eingeführt, für Modelle mit Verbrennungsmotoren wurde eine neue Berechnungsgrundlage eingeführt, die stärker nach der tatsächlichen Leistung und dem Erstzulassungs-datum differenziert.
Blaues Auge mit Aufgaben bei den Angaben
Während der unterschiedlichen Regierungsverhandlungen war lange nicht klar, wohin die Reise bei den Autosteuern geht. Nun gibt es mit der motorbezogenen Versicherungssteuer für E-Autos und dem Wegfall der NoVA für N1-Fahrzeuge endlich Klarheit. Natürlich sind die beiden Änderungen keine optimalen Signale für den Hochlauf der E-Mobilität, wir sind aber der Meinung, dass die Branche mit einem blauen Auge davongekommen ist. Beide Veränderungen werden den elektrischen Hochlauf leicht beeinträchtigen und damit den Druck auf die CO2-Bilanz im Verkehr leicht erhöhen. Aber die Folgen sind überschaubar, schließlich muss jeder seinen Beitrag zum Budget leisten.
Dabei tut sich allerdings ein anderes Thema auf: die Beschreibung der E-Fahrzeuge. Schon bisher ist es verwirrend, dass – etwa in den Gebrauchtwagen-Plattformen – meistens die Spitzenleistung, manchmal aber die Dauerleistung bei Inseraten angegeben ist. Bislang war die Dauerleistung für den Konsumenten nicht relevant, durch die motorbezogene Versicherungssteuer ist sie das jetzt. Gleichzeitig will der Kunde wissen, was das Auto – auch im Vergleich zum Verbrenner – leistet. Es braucht also beide Informationen. Derzeit herrscht – nicht nur beim Gebrauchtwagen, sondern auch bei Neuwagen-Inseraten – ein Durcheinander.
Die Branche benötigt also dringend eine einheitliche und übersichtliche Lösung für die Angabe der Leistung von Elektrofahrzeugen.