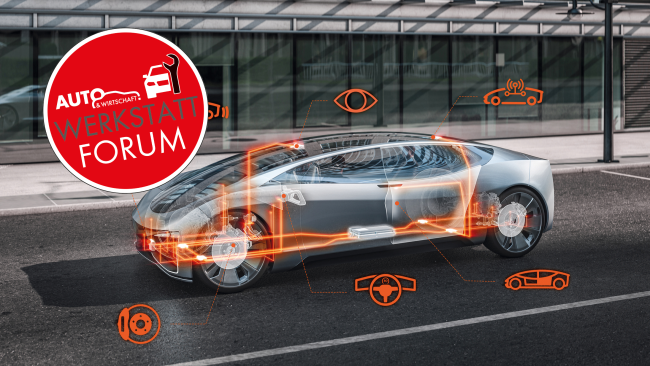Moderne Fahrzeugtechnologien halten die nachgelagerten Einheiten in der Kfz-Branche zusehends auf Trab. „Die Fahrzeugtechnik hat sich zu einem enorm anspruchsvollen und vielseitigen Handwerk entwickelt“, meint Wilfried Stöckl, Generalsekretär des VFT – Verband der freien Kfz-Teile-Fachhändler. Besonders beliebte und erfolgreiche Automodelle in den vergangenen Jahrzehnten waren meist jene, bei denen klar war, dass sie jederzeit und unkompliziert reparierbar sind. Bei diesen Fahrzeugen stand die Mechanik im Vordergrund. Mehr und mehr Elektronik, der Einsatz von computergestützten Systemen und die steigende Bedeutung von Software und Vernetzung haben die Komplexität von Fahrzeugen jedoch massiv erhöht.
Neue Fahrzeuggenerationen, Verbrenner genauso wie Hybride und E-Autos, sind darum immer stärker von zuverlässiger Elektronik und Software abhängig. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung noch lange nicht an ihrem Ende angekommen ist. „Rund um das Auto und dessen Nutzung wird sich ein umfassendes digitales, datengesteuertes Ökosystem entwickeln“, so Stöckl. Denkt man etwa an die Bereiche Fahrzeugdiagnose oder ADAS-Kalibrierung, ist diese Entwicklung schon heute erkennbar.
Digitale Werkzeuge werden immer wichtiger
Die Verfügbarkeit, der Zugang und das Wissen um die Anwendung solcher digitalen Werkzeuge werden immer wichtiger. Nehmen wir das Beispiel der Pannendienste: Für sie gehört die Fehlersuche im Fahrzeug mit Hilfe digitaler Diagnosegeräte zum Alltag. Diese Diagnose ist aber bei zahlreichen, technisch und digital hochgerüsteten, modernen Fahrzeugmodellen für unabhängige Marktteilnehmer kaum noch bzw. gar nicht mehr möglich. Das bedeutet, dass Fahrzeugtechniker und -technikerinnen von Pannendiensten und freien Werkstätten bei ihrer Arbeit benachteiligt werden, weil notwendige Daten und Informationen nicht verfügbar oder nicht zugänglich sind.
Freier Reparatursektor kommt unter Druck
„Wir sehen, dass das Ungleichgewicht der Kräfte zum Nachteil des unabhängigen Reparatursektors im Fahrwasser der Digitalisierung schleichend größer wird“, sagt Stöckl. Zu den Bereichen, wo es schon heute eindeutig Verbesserungspotenzial für in Europa typgenehmigte Fahrzeuge gibt, gehören etwa die lückenlose Verfügbarkeit von Reparatur- und Wartungsinformationen und der durchgängig sichergestellte Zugang zur Diagnoseschnittstelle.
Eine Schwächung des Wettbewerbs ist aber auch im Bereich der Ersatzteile zu verzeichnen. Besonders betroffen von Monopolisierungstendenzen sind Hightech-Komponenten und verschiedene Karosserieteile. Derartige – auch als „Captive Parts“ bezeichnete – Bauteile können von Werkstätten ausschließlich über das Netzwerk des Fahrzeugherstellers bezogen werden. Besonders auffällig sind dabei Fahrzeughersteller, die mit ihren Produkten neu in den EU-Markt kommen.
Konkurrenz belebt jedoch das Geschäft. Das mag für manche nach einer abgedroschenen Phrase klingen, trifft aber gerade auf den Kfz-Reparatursektor zu. Der Wettbewerb hat Auswirkungen auf viele Bereiche, von denen schlussendlich auch jede Autofahrerin und jeder Autofahrer profitiert: Er hat Einfluss darauf, welche Leistungen – zu welcher Qualität und zu welchem Preis – ein Betrieb anbietet und wie produktiv gearbeitet wird. Wer langfristig im Geschäft bleiben will, wird darum versuchen, seinen Kundinnen und Kunden ein attraktiveres Gesamtpaket zu bieten als seine Mitbewerber.
Aftermarket-GVO ist unverzichtbar
Im Aftermarket stehen jedoch viele kleinere Betriebe wenigen sehr großen Konzernen gegenüber. Es herrscht ein Ungleichgewicht der Kräfte. Ein fairer Ausgleich ist in diesem Fall darum nur über entsprechende, verbindliche Marktregeln möglich. Aus Sicht der unabhängigen Unternehmen ist die Aftermarket-GVO (Gruppenfreistellungsverordnung) darum so etwas wie die Mutter aller Regeln. Sie schützt die vielen Klein- und Mittelbetriebe im Wettbewerb mit großen, oft global operierenden Autoherstellern. „Wir dürfen davon ausgehen, dass die Reparaturlandschaft ohne dieses wichtige EU-Regelwerk vollkommen anders aussehen würde und es kaum unabhängige Dienstleistungen rund ums Auto geben würde“, meint Stöckl. Das hätte für große Teile der Bevölkerung in Österreich erhebliche Auswirkungen – von höheren Kosten bis zur schlechteren Versorgung. „Wir beobachten, dass kleinere, lokal verankerte Reparaturbetriebe gerade in jenen Region einen wichtigen Beitrag zur Mobilitäts-Nahversorgung leisten, in denen die Bevölkerung auf ein funktionstüchtiges und verkehrssicheres Fahrzeug angewiesen ist“, erklärt Stöckl.
Ziel: die GVO inhaltlich stärken
Die EU-Kommission hat die GVO zuletzt nur um fünf Jahre, mit Gültigkeit bis 2028, verlängert und darum jetzt auch schon wieder einen neuen Prüfprozess eingeleitet. Nach Abschluss dieser Prüfung wird die Kommission entscheiden, ob bzw. in welcher Form die GVO auch nach 2028 fortgeführt wird. „Die GVO ist wichtig für Wirtschaft und Gesellschaft. Jetzt geht es darum, die GVO inhaltlich stärker mit dem technologischen Fortschritt abzugleichen und so zukunftsfit zu machen“, so Stöckl. „Für ein Gleichgewicht der Kräfte müssen wir aber gleichzeitig auch die Durchsetzbarkeit verbessern. Es braucht stärkere, EU-weit durchsetzbare Mechanismen, damit bestehende Regeln effektiver angewendet werden können. Unsere Aufgabe als VFT ist es nun, die politischen Entscheidungsträger davon zu überzeugen.“
Unterstützung durch die Politik
In seiner Stellungnahme an die EU-Kommission vom 24.6.2024 betonte das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW), dass es erforderlich ist, dass „Handels- bzw. Reparaturunternehmen vor problematischen und dem Wettbewerb abträglichen Geschäftspraktiken ihrer marktmächtigen Vertragspartner (Hersteller und Importeure) geschützt werden“.
Die wichtigsten Argumente des BMAW kurz zusammengefasst:
• Ungleichgewicht ausgleichen: Hersteller dominieren – Händler & Werkstätten brauchen Schutz.
• E-Mobilität fordert KMU: Der Umstieg stellt kleine Betriebe vor große Herausforderungen.
• Daten sind Macht: Zugang zu vernetzten Fahrzeugen und Fahrzeugdaten ist entscheidend, um Wettbewerbsverzerrung zu verhindern.
• Verbraucher im Fokus: Konsumenten sollen selbst entscheiden, wer ihre Fahrzeugdaten nutzt.