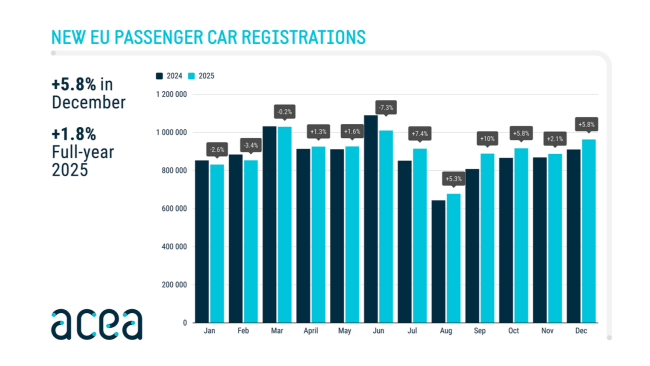Während ich diese Zeilen verfasse, liegt eine Vielzahl an Terminen quer durch die Republik hinter mir. Und in nahezu allen von mir angesteuerten Karosserie- und Lackierbetrieben berichteten mir die Verantwortlichen von hoher Auslastung und einer guten Geschäftslage. Die Gründe dafür sind bekannt: Noch immer herrscht eine gewisse Unsicherheit in der Bevölkerung vor – Unklarheiten bei von der Politik vorgegebenen Rahmenbedingungen sind da nicht gerade dienlich. Kann ich mir ein neues Fahrzeug überhaupt leisten, welchen Antrieb soll ich wählen oder fahre ich nicht lieber mein aktuelles Gefährt noch ein wenig länger weiter? Viele entscheiden sich für die letztgenannte Variante, was naturgemäß dem Reparaturmarkt zugutekommt. Aber gleichzeitig werden Instandsetzungen, aufgrund gestiegener Ersatzteil-, Lohn- und Gehaltskosten, immer teurer. Jetzt sind wir in Österreich in der glücklichen Lage, dass die Versicherungen nach wie vor gewillt sind, auch ältere Fahrzeuge mit Neuteilen reparieren zu lassen. Und eines muss auch festgehalten werden: Die Anzahl der Schäden geht zwar zurück, die Schadenhöhe hingegen steigt aber von Jahr zu Jahr. Von Versicherungsseite wird es in Zukunft wohl nicht mehr das aus der Gegenwart bekannte Entgegenkommen geben, denn auch die Versicherungsprämien lassen sich nicht ins Uferlose erhöhen.
Aus diesem Grund ist intensives Nachdenken von allen Branchenbeteiligten gefragt. Weder lassen sich die Stundensätze in den Kfz-Betrieben noch die Versicherungsprämien stetig nach oben schrauben – und das schon gar nicht in Zeiten, in denen Autofahrerinnen und Autofahrer für ihren motorisierten Untersatz bereits sehr tief ins Börserl greifen müssen. Gleichzeitig muss die Bevölkerung nachhaltig (auto-)mobil gehalten werden. Der immer älter werdende Fahrzeugbestand und die fehlenden Pkw-Neuzulassungen der vergangenen Jahre werden auch das Werkstattgeschäft in einigen Jahren einholen – in Zukunft wird es schlichtweg an Aufträgen fehlen.
Ein Ausweg aus dieser Situation ist die Rückbesinnung auf die traditionellen Werte des Handwerks und hier vorrangig die handwerklichen Fähigkeiten. In Kombination mit einer noch in vielen Fällen verbesserungswürdigen Reparaturfähigkeit der Fahrzeuge wird es notwendig sein, wieder mehr Gespür dafür zu bekommen, dass der bloße Austausch von Teilen zwar bequem ist, aber wenig handwerklichen Geschickes bedarf und auch einer nachhaltigen Ausrichtung nicht besonders entgegenkommt. Denn sowohl die Produktion von Neuteilen als auch die Verwertung von Altteilen sind mit hohen CO2-Emissionen verbunden. Die Reparatur von beschädigten Teilen direkt durch die Spezialisten in den Werkstätten bzw. die Verwendung von wiederaufbereiteten Komponenten könnten sich als vorteilhaft erweisen – vor allem in Hinblick auf die zu erwartende Verschärfung der CO2-Berichtspflichten von Unternehmen. Es wird nicht mehr lange dauern und Versicherungen, Großauftrag- und Geldgeber werden beim kleineren und mittleren Karosserie- und Lackierbetrieb anklopfen und nachfragen, wie es denn eigentlich um dessen ökologischen Fußabdruck bestellt ist.
Neben der Hinwendung zu den Werten des Handwerks muss aber auch der Servicegedanke noch stärker gelebt werden. Viele Betriebe, vor allem im ländlichen Bereich, sind in der Region stark verankert und unterhalten in vielen Fällen freundschaftliche Verbindungen zu ihrer Kundschaft. Eine schlechte Nachrede kann sich dort keiner der Firmenchefs leisten. Im Ballungsraum ist das anders: Die Anonymität im Umgang mit den Kunden und eine in manchen Fällen deutlich zur Schau getragene Unzufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsplatz sind dort der Servicequalität und damit der Kundenzufriedenheit nicht gerade förderlich.