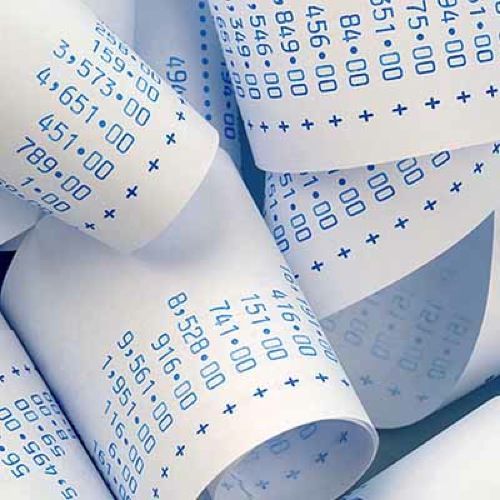Fehler, die zu Garantie-Reparaturen führen, sind bei der Auslieferung meist noch nicht erkennbar. Die fehlerhaften Autos landen beim Endkunden, der beim Händler reklamiert. Die Erledigung dieser Reklamationen kostet Geld. Wenn es um den Ersatz dieser Kosten geht, sind die Produzenten knauserig. Die KMU Forschung Austria hat schon vorzwei Jahren belegt, dass die Kfz-Betriebe bei den Garantie-und Gewährleistungsarbeiten viel Geld verlieren. Aber: Muss das so sein?
Nach der Gesetzeslage haben esÖsterreichs Kfz-Betriebe beim Garantieregress gut: Denn seit 2013 gibt es das KraSchG. Mit dem sind die Hersteller gesetzlich verpflichtet, den Vertragswerkstätten den notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen. Wenn in deren Garantiehandbüchern etwas anderes drin steht, so sind diese Bestimmungen unwirksam. Die Realisierung dieses gesetzlichen Anspruches schaut jedoch recht triste aus.
2013 kam der durchschnittliche Vertragshändler auf einen Umsatz von 2,9 Millionen Euro. 30 Prozent - somit 870.000 Euro -machte er dabei mit seiner Werkstätte. Im Durchschnitt erzielten die Betriebe 2013 einen Gewinn vor Steuern von 0,9 Prozent des Umsatzes, das sind rund 26.100 Euro. Diese Daten veröffentlichte Ende Jänner 2015 die KMU Forschung Austria.
Ertragslage wäre deutlich besser
Vom Werkstättenumsatz entfallen etwa 10 Prozent auf Garantiefälle. Diese 87.000 Euro Garantieumsatz bescherten dem Betrieb 2013 einen Verlust von 24.650 Euro. Bei einer vollen Refundierung des Garantieaufwandes hätte sich die Ertragslage auf 50.150 Euro bzw. 1,7 Prozent des Umsatzes verbessert.
Bei der ersten Studie im Jahr 2009 betrug der Garantieverlust "nur" 20.340 Euro. Es zeigt sich somit, dass die Verluste größer und nicht kleiner wurden. Die KMU Forschung hat sich in einer vertieften Analyse auch die größeren Betriebe mit einem Netto-Umsatz von 4,6 Millionen Euro angesehen. Die kommen auf einen Garantieumsatz von 138.000 Euro und auf einen daraus resultierenden Fehlbetrag von 39.100 Euro. Bei diesen Unternehmen würde sich durch eine volle Refundierung des Garantieaufwandes die Rentabilität von 1,1 auf 1,9 Prozent des Jahresumsatzes erhöhen. Womit auch diese Werte weit unter den 3,75 Prozent einer "normalen" marktorientierten Wirtschaft liegen. Das Thema brennt daher allen Markenbetrieben auf den Nägeln -ob sie sich nun damit auseinandersetzen oder nicht.
Abschlag von 10 Prozent vereinbart
Derartige Daten haben bei einigen Händlerverbänden die Alarmglocken schrillen lassen. "Wir von VW haben über den Europäischen Händlerverband beim Institut für Automobilwirtschaft noch eine weitere Studie machen lassen", sah sich Dr. Josef Lamberg für die erforderlichen Verhandlungen mit dem Hersteller gut munitioniert. "Da warinternational schon einiges in Arbeit", sagt Verbandsobmann Stefan J. Hutschinski (Autohaus John): Seiner Meinung nach habe auch das KraSchG mit dazu beigetragen, eine halbwegs ausgeglichene Lösung zu finden.
Vom Kunden-Stundenpreis wurde ein Abschlag von 10 Prozent vereinbart. "Da ist der Hersteller wie ein Großkunde", meint Hutschinski; so werden die vom jeweiligen VW-Partner echt verrechneten Werte als Basis herangezogen. Für Ersatzteile wird eine Marge von 15 Prozent gewährt. "Am Anfang hatten wir nur eine Handlingmarge von 3 Prozent bei einem Aufwand von 18 Prozent", erläutert Lamberg, der das Ergebnis jahrelanger Bemühungen nicht an die große Glocke hängen will. "Auch bei den Arbeitszeitvorgaben gibt es keine nennenswerten Beschwerden", sagt Hutschinski. Aus seiner Sicht war es möglicherweise hilfreich, dass mit Porsche Inter Auto die mit Abstand größte Autohandelsgruppe auf Händlerseite im selben Boot saß.
Für Einzelhandelssprecher Sepp Schirak ist klar, dass den Vertragspartnern die Vollkosten derartiger Gewährleistungsarbeiten zu ersetzen sind. Schließlich liegt die Ursache der Kundenreklamation beim Hersteller und nicht beim Händler. "Da haben die Betriebe auch für völlig fremde Fahrzeuge einevertragliche Reparaturpflicht übernommen." Eigentlich hätten diese Arbeiten direkt die Hersteller zu erledigen.
Wie mühsam der Weg zum Kostenersatz ist, zeigt sich etwa bei Peugeot. "Wir haben bereits den vierten Ansprechpartner", sagt Händlersprecher Bernd Kalcher. Dieses heiße Eisen wurde bisher stets von einem Kundendienstdirektor zum nächsten weitergereicht. Peugeot wurde auch angeboten, die Studie der KMUForschung markenspezifisch zu vertiefen. Ein Vorschlag, der auf wenig Gegenliebe stieß.
Händlerverbände agieren nun gemeinsam
Ähnlich die Situation bei Citroën: Weshalb beide Händlerverbände beschlossen, das Problem nun gemeinsam anzugehen - auch da bei den beiden Marken viele gleichartige Garantiearbeiten anfallen, jedoch unterschiedlich vergütet werden. Citroën-Sprecher Andreas Parlic wird daher mit einigen Testbetrieben die Unterschiede zwischen der Garantieabrechnung und der Kundenabrechnung untersuchen. Diese Werte werden dann mit den Ergebnissen von Peugeot-Testbetrieben verglichen. Auf dieser Basis sollten Gespräche mit dem Hersteller geführt werden.
Und wenn diese erfolglos bleiben? Dann haben die Händlerverbände beschlossen, die Vergleichsergebnisse im Rahmen des §-7-Verfahrens von einem von der Schlichtungsstelle bestimmten Sachverständigen überprüfen zu lassen. Und wenn das zu keinem Ergebnis führt, können sie bei Gericht auf Feststellung klagen, dass die nachteiligen Garantieregelungen des Händlervertrages unwirksam sind. Und der Hersteller daher verpflichtet ist, für die eingeklagten Garantiearbeiten die vollen Kosten zu bezahlen.
Die Verlustquellen
Die KMU Forschung hat untersucht, wo bei der Garantieabrechnung das Geld zum Fenster rausfliegt:
>Im Durchschnitt müssen die Händler einen Abschlag von 13 Prozent auf den normalen Kundenverrechnungssatz akzeptieren.
>Hinzu kommt, dass die Vorgabezeiten zu knapp sind, daher nur ein Teil der von den Kfz-Technikern tatsächlich geleisteten Stunden bezahlt wird. Dadurch reduziert sich die Refundierung auf 75 Prozent.
>Bei Spengler-und Lackiererarbeiten sind es gar nur 65 Prozent.
>Die Handling-Kosten für Ersatzteile bei "normalen Reparaturen" liegen bei 20 Prozent des Netto-Einstandspreises. Davon werden aber durchschnittlich 5 Prozent refundiert.
>Durch die zusätzlichen Vorschriften für Garantieabwicklungen erhöht sich der Handling-Aufwand um 5 Prozent auf 25 Prozent, beträgt die Unterdeckung (der Verlust) somit 20 Prozent des Einstandspreises.
>Hinzu kommt der zusätzliche administrative Aufwand der Garantieabwicklung. Im Vergleich zum Kundenauftrag sind das 1 Stunde und 15 Minuten, die der Betrieb dem Hersteller "schenkt".
Kraftfahrzeugsektor-Schutzgesetz:
Garantie-und Gewährleistungsvergütungen
§ 5. Hat ein gebundener Unternehmer aufgrund der Vertriebsbindungsvereinbarung oder wegen eines Mangels, der bereits bei Auslieferung an den gebundenen Unternehmer vorlag, Garantieleistungen erbracht oder Gewährleistungsansprüche befriedigt, so hat der gebundene Unternehmer gegenüber dem bindenden Unternehmer Anspruch auf Ersatz des mit den Leistungen verbundenen notwendigen und nützlichen Aufwands.
§ 2. Soweit in Vereinbarungen von diesem Bundesgesetz zum Nachteil des gebundenen Unternehmers abgewichen wird, sind sie unwirksam.