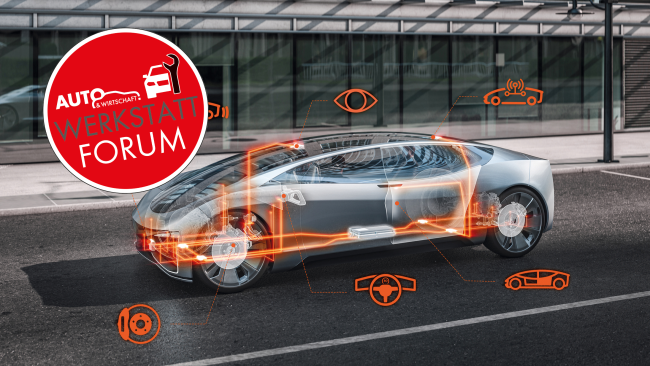Wirft man einen genauen Blick auf die Werkstätten-Landschaft in den EU-Staaten, so wird ersichtlich, dass 82 Prozent aller Kfz-Werkstätten markenungebunden sind. Diese vereinen 62 Prozent des Marktvolumens von Ersatzteilen und Komponenten auf sich. Das gesamte Volumen des freien Marktes wird mit 73 Milliarden Euro beziffert, für den Gesamtmarkt stehen 118 Milliarden Euro zu Buche. Zum Vergleich: Der weltweite Umsatz mit Kfz-Ersatzteilen und -Services hat 2023 rund 430 Milliarden Euro betragen.
Diese Zahlen spiegeln sehr gut wider, wie wichtig der freie Markt für das Funktionieren des gesamten Reparatursektors in Österreich ist – allein im Hinblick auf die angespannte Finanzlage vieler Privathaushalte. Mobilität muss prinzipiell ermöglicht und in weiterer Folge gesichert werden – dazu tragen unter anderem zeitwertgerechte Reparaturverfahren für ältere Fahrzeuge bei. Dass auch hier keine Kompromisse hinsichtlich Qualität und damit Verkehrssicherheit eingegangen werden, ist der hohen Kompetenz des Kfz-Teilehandels geschuldet, der durchgängig auf Produkte von Qualitätsherstellern setzt.
Dafür dass der freie Reparaturmarkt gegenüber den Markenherstellern und ihren angeschlossenen Werkstätten nicht ins Hintertreffen gerät, trägt auch ein spezieller EU-Rechtsrahmen Vorsorge – die Aftermarket-GVO (Gruppenfreistellungsverordnung). Sie gewährleistet, dass freie Betriebe Zugang zu allen auf dem Markt befindlichen Fahrzeugen erhalten und diese entsprechend servicieren und reparieren können. Das Ganze natürlich ohne Auswirkungen auf Garantie- und Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller. Auch das wird in der Praxis vielfach anders kommuniziert, womit Endverbraucher unnötig verunsichert werden.
Dem freien Markt weht ohnehin oftmals ein rauer Wind entgegen. Um mit den Anforderungen moderner Fahrzeuge Schritt halten zu können, braucht es eine entsprechende technische Ausstattung der Betriebe und einen möglichst barrierefreien Zugang zu den im Fahrzeug (in Echtzeit) generierten Daten. Entsprechende Rechtsvorschriften zu letztgenanntem Punkt gibt es zur Genüge, aber nicht immer werden diese in der Praxis auch so exekutiert, dass der freie Markt uneingeschränkt seine Arbeit verrichten kann.
Die derzeitige GVO wurde 2023 um fünf weitere Jahre bis 2028 verlängert. Der entsprechende Prüfprozess ist bereits eingeleitet worden. Es ist aber nicht sicher, ob und wie eine erneute Verlängerung der GVO ausgestaltet werden wird. Es liegt also an den betroffenen Verbänden, bei den politischen Verantwortungsträgern effektives Lobbying zu betreiben, um ihre Position gegenüber den finanzstarken und politisch gut vernetzten Automobilherstellern zu behaupten.