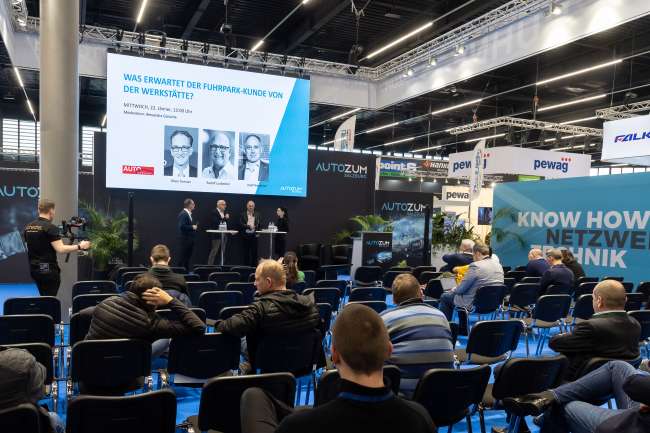Nach 2023 (-1,0 Prozent) und 2024 (-1,2 Prozent) wird Österreich auch 2025 das dritte Jahr in Folge in einer Rezession verharren. Für 2025 erwarten die Experten des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 0,3 Prozent. Zum Vergleich: Das BIP der Staaten der Europäischen Union soll laut WIFO in diesem Jahr um 1,3 Prozent zulegen. Die Wirtschaftsforscher rechnen für heuer zudem mit einem Exportrückgang von 0,9 Prozent, einem Minus von 0,7 Prozent bei den Bruttoanlageinvestitionen sowie mit einem nur leichten Plus beim privaten Konsum von 0,2 Prozent. Eine Konjunkturaufhellung, so das WIFO, könnte sich im 2. Halbjahr 2025 einstellen.
Wenig Grund für Optimismus
Soweit die nüchternen Zahlen, die allerdings noch schlechter ausfallen könnten. Denn als das WIFO Anfang April seine erste Konjunkturprognose für 2025 veröffentlichte, waren die Rahmenbedingungen noch andere: „Und dann kam Trump“, fasst es Dr. Klaus Friesenbichler, Senior Economist beim WIFO und stellvertretender Direktor am Lieferketteninstitut ASCII, kurz und prägnant zusammen. Der Schlingerkurs des US-Präsidenten in der Wirtschaftspolitik (Zölle etc.) werde dazu führen, dass die Konjunktureinschätzungen für 2025 und 2026 noch trüber ausfallen könnten. „Die bisher getätigten Annahmen befinden sich am oberen Rand.“
Schwarze Null ist „eine schlechte Nachricht“
Auch das zu erwartende leichte Plus beim privaten Konsum sieht Friesenbichler mit Vorsicht: „Eine schwarze Null beim Konsum ist eine schlechte Nachricht.“ Davon ist auch die Kfz-Branche betroffen. Die Konsumenten seien verunsichert, man spare beim Neuwagen. Von den Pkw-Absatzzahlen in der Prä-Corona-Ära ist man, wie landläufig bekannt, weit entfernt: „Es fehlt im Volumen und auch in der Qualität“, so Friesenbichler. Im Gebrauchtwagen-Segment sei die Lage hingegen deutlich besser.
Alte Technologien kommen unter Druck
Friesenbichler ist auch Teil eines internationalen Forschungsteams, das sich mit der Wertschöpfungskette der globalen Automobilindustrie beschäftigt – konkret mit der Produktion von Fahrzeugen und welche Komponenten dafür benötigt werden. Die globale Industrierezession trifft die Automobilindustrie hart, zudem schweben viele Fragezeichen über der Zukunft des Freihandels. Eng mit europäischen und internationalen Herstellern ist auch die österreichische Automobil-zulieferbranche verknüpft. „Wir beobachten hier einen starken Strukturwandel mit einigen Gewinnern und Verlierern.“ Der Makrotrend geht von weniger Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor aus, davon seien beispielsweise die Werkstätten und das Tankstellennetz betroffen. „Sämtliche Infrastruktur, die an alten Technologien festhält, kommt unter Druck“, betont der Ökonom. Personal würde auch hinkünftig benötigt, allerdings müsse sich das Ausbildungssystem den neuen Gegebenheiten anpassen.
Neue Geschäftsmodelle sind unabdingbar
Für das Automobilzuliefersegment ortet er eine weiter anhaltende Rezession: „Es wird weitere Insolvenzwellen geben.“ Der Strukturwandel und die Hinwendung zur E-Mobilität werde auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben: „In der E-Auto-Produktion werden im Vergleich zu Verbrennerfahrzeugen ein Drittel bis ein Viertel weniger Arbeitskräfte nachgefragt, das wird sich in den regionalen Arbeitsmärkten widerspiegeln“, erwartet der Ökonom. Der Weg in eine nachhaltige(re) automobile Zukunft wird naturgemäß stark von Politikdynamiken begleitet. „Die Ausgangslage ist keine neue“, gibt der WIFO-Experte zu bedenken.
Branchenteilnehmer, vor allen die arrivierten, müssten ihre Geschäftsmodelle überdenken. Am Beispiel der Batterietechnologie habe sich gezeigt, dass europäische Hersteller bei Technologie und Produktion nicht mit dem asiatischen Mitbewerb mithalten könnten. „Man hinkt bei Qualität und Kosten hinterher“, stellt Friesenbichler fest. Das zeige auch die aktuelle Forschung am Lieferketteninstitut ASCII. Die Technologien seien vielfach abgewandert, man beschränke sich in vielen Fällen auf bestehende Geschäftsmodelle und dann gebe es noch das Thema Regulierung, das zukunftsgerichteten Lösungen manchmal im Wege stünde, lautet seine Zusammenfassung.
In der Werkstätte läuft es besser
Schon seit einigen Jahren sorgt der Rückgang bei den Pkw-Neuzulassungen, der starke Gebrauchtwagenabsatz und der generell alternde Fahrzeugbestand für eine gute Auslastung in den Kfz-Werkstätten. Blickt man auf das Jahr 2024, so weist die von der KMU Forschung Austria durchgeführte Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk für den Bereich Kraftfahrzeugtechniker (inklusive Vulkaniseure) Zuwächse auf. Konkret meldeten 54 Prozent der Betriebe einen höheren Umsatz als 2023, bei 29 Prozent blieb der Umsatz unverändert und 17 Prozent der Betriebe mussten Umsatzrückgänge im Schnitt um 10 Prozent hinnehmen. 2024 wurde im Branchendurchschnitt eine Erhöhung des nominellen Umsatzes um 1,8 Prozent verzeichnet, womit die Umsätze im langfristigen Vergleich etwa auf dem Niveau von 2019 lagen.
Im 1. Quartal 2025 verzeichneten 10 Prozent (2024: 15 Prozent) der Betriebe eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, 58 Prozent traten beim Umsatz auf der Stelle und 32 Prozent mussten Rückgänge beim Umsatz in Kauf nehmen. Damit war die Lage sowohl im Vergleich zum Vorjahresquartal als auch zum Vorquartal schlechter, schreiben die Konjunkturbeobachter. Auch für das 2. Quartal 2025 herrscht nur bedingt Optimismus vor: 14 Prozent (2024: 19 Prozent) der befragten Unternehmen gehen von steigenden Umsätzen aus, 61 Prozent (2024: 57 Prozent) erwarten keine Veränderung, und 25 Prozent (2024: 24 Prozent) stellen sich sogar auf sinkende Umsätze ein.
Investitionsbereitschaft ist gegeben
Für 2025 ist durchaus mit einer Bereitschaft für Investitionen zu rechnen: 44 Prozent der Betriebe planen, Investitionen zu tätigen, 28 Prozent rechnen mit höheren Investitionen als im Vorjahr, 9 Prozent wollen gleich viel investieren und 7 Prozent wollen dafür weniger Geld in die Hand nehmen. Nach wie vor sind die Unternehmen mit großen Herausforderungen konfrontiert. 61 Prozent der Befragten nannten hier Steuern und Abgaben, 59 Prozent Preissteigerungen bei Energie, 56 Prozent den Fachkräftemangel, ebenso 56 Prozent Bürokratie und Verwaltung und 52 Prozent Preissteigerungen bei Rohstoffen und Materialien.
Die Lage in den Markenbetrieben und die Werkstättenauslastung nimmt der Händler-Trend Barometer der puls Marktforschung in Kooperation mit der Santander Consumer Bank und AUTO & Wirtschaft genauer unter die Lupe. Hier lag die durchschnittliche Auslastung im 1. Quartal 2025 bei 83,4 Prozent – der niedrigste Wert seit Anfang 2022 (79,6 Prozent). Zum Vergleich: Im 1. Quartal 2024 lag die Auslastung bei 86,2 Prozent, im 4. Quartal 2024 bei immerhin 88,8 Prozent.