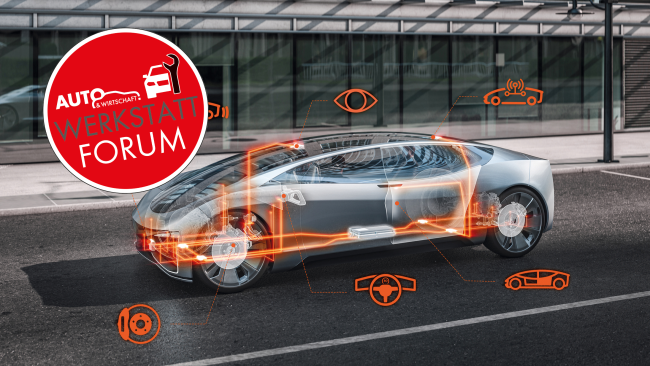Wenn etwas schiefläuft, dann sind immer die anderen schuld. An dieser Maxime orientieren sich nicht nur die Politiker, sondern auch die Kapitäne der Automobilkonzerne. Die Politiker schieben die Schuld an der galoppierenden Inflation und der heranziehenden Stagflation (Inflation plus „Minus-Wachstum“) dem Coronavirus, den Chinesen und Putin in die Schuhe. Nicht ihrer eigenen Wirtschaftspolitik. Mit gut gemeinten (wenig wirksamen) Sanktionen und einer ungezügelten Geldschwemme der EZB. Mit Billionen frisch „gedruckter“ Digital-Euros, die lediglich in den Köpfen der Politiker und ihrer Notenbanker existieren.
Wie die Politiker suchen auch die Konzernlenker der Autoindustrie die Schuld an der – schon länger andauernden – Produktions- und Liefermisere bei der Pandemie, den Russen und den Chinesen. Aber natürlich nicht bei sich selbst. Bei einem Wettlauf, bei dem sie wie Hamster im Rad dem Ziel einer 10-prozentigen Rendite nachlaufen, während der von ihnen abhängige Händler schon jahrelang zwischen null und ein Prozent herumdümpelt. Schuld an der Misere hat allenfalls der „Markt“ oder die „Börse“, die sie zu solch einem Wettlauf zwingen. Überdies seien derartige Gewinne erforderlich, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
Für dieses Renditen-Ziel wurde im Laufe der Jahre der Produktionsablauf umgekrempelt. Jeder Produktionsschritt hat „just in time“ zu erfolgen. Sämtliche Vormaterial- und Halbfertigteile- und Zwischenlager wurden abgeschafft. Gleichzeitig wurden auch die Vorlieferanten so unter Druck gesetzt, dass sich diese keine Vormaterial- und Zwischenlager mehr leisten können. Überdies ist seit Jahren „Outsourcing“ das Gebot der Stunde: Möglichst wenig eigene Mitarbeiter, die viel Geld kosten und krank werden können. Wenn schon Mitarbeiter, dann Lohnarbeiter. Die kann man bei Auftragslücken oder bei sonstigen Betriebsproblemen leicht an den Verleiher zurückschicken. Eine kaufmännische Notwendigkeit, um in diesem Renditenwettlauf flexibel und wettbewerbsfähig zu bleiben. Alles andere könnte die „Börse“ und ihre gierigen Aktionäre verstimmen.
Kommt aus Rentabilitätserwägungen auch diese Strategie zu teuer, lassen sich Arbeitskräfte durch Maschinen ersetzen. Ist dies zu aufwendig, dann müssen Teile der Produktion in fernöstliche Niedriglohnländer ausgelagert werden. In Länder, die auch nicht vom Energieembargo der EU betroffen sind. Oder in Länder wie die USA, die als Erdöl- und Erdgasproduzent davon profitieren. Denn die Preis- und Versorgungsprobleme bei Strom und Gas sind in erster Linie ein EU-Problem: Europäische Gaskunden zahlen derzeit neunmal mehr als jene in den USA. Auch Erdöl ist dank des „Frackings“ mehr als ausreichend vorhanden; weshalb an den US-Zapfsäulen ein Liter Benzin bloß einen Euro kostet.
Derart aus Europa ausgelagerte Produktionen verlängern natürlich auch die Transportwege und -risiken. Doch auch das hat die Rentabilität der Autoproduzenten bisher nicht beeinträchtigt. Da lassen sich erfolgreich Spediteure und Frächter unter Druck setzen, die sich vielfach in Abhängigkeit dieser Großkunden begeben haben. Wenn dann irgendwo auf der Welt die Lieferketten unterbrochen sind und die Kfz-Fertigung mangels „second source“-Lieferquellen zum Stehen kommt, können sich die europäischen Lenker der Autokonzerne immer noch auf die verfehlte Energiepolitik der EU berufen.
Für die Industrie ist es bei der weltweiten Globalisierung kein besonderes Problem, die Produktion über Ländergrenzen hinweg zu transferieren. Pech haben nur die von diesen Autokonzernen abhängigen ortsgebundenen Autohändler. Die bleiben auf den traurigen Folgen und Verlusten dieser Wirtschafts- und Industriepolitik sitzen.
Der A&W-Verlag bildet ein breites Meinungsspektrum ab. Kommentare müssen nicht der Meinung des Verlages entsprechen.