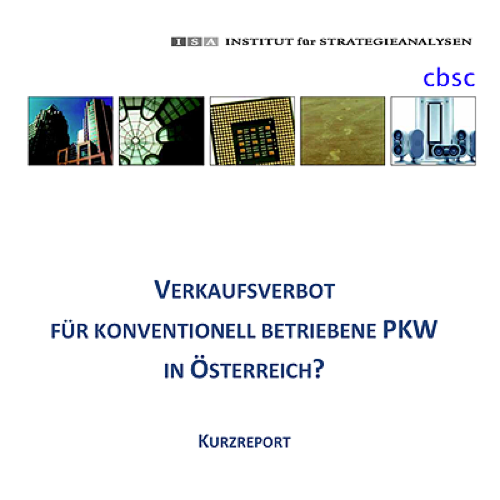Exakt 1.677 Elektroautos wurden inÖsterreich 2015 neu zugelassen -viel zu wenige, um die Emissionsbilanz in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Die Nachfrage nach elektrisch angetriebenen Fahrzeugen steigt zwar, doch das Regierungsziel von 200.000 Bestandsfahrzeugen im Jahr 2020 scheint unerreichbar.
Gefährliches Szenario
Angesichts dessen denkt man mancherorts an drastische Einschnitte: In seiner Mitte April präsentierten Studie "Szenario Erneuerbare Energie" postuliert das Umweltbundesamt, dass "der Verkauf von konventionell betriebenen Pkws stark eingeschränkt wird und gegen null geht". Bereits ab 2020 sollen nur noch elektrisch betriebene Pkws verkauft werden. Bei schweren Nutzfahrzeugen soll bis 2050 eine Umstellung auf Brennstoffzellenantrieb erfolgen. Derartige Überlegungen gibt es auch in anderen EU-Staaten: In Norwegen diskutiert das Parlament über ein Verkaufsverbot ab 2025. Angesichts großzügiger Förderungen entfallen dort freilich schon jetzt 22 Prozent der Neuzulassungen auf Elektroautos und Plug-in-Hybride. In den Niederlanden, wo der Marktanteil der "Stromer" zuletzt bei 9,7 Prozent lag, wird über eine ähnliche Regelung debattiert. Verbotspläne könnten also schneller Realität werden, als gemeinhin angenommen wird. Nicht nur für die Automobilwirtschaft wäre dies einSchreckensszenario: Das zeigt eine wissenschaftliche Untersuchung, die das Institut für Strategieanalysen (ISA) für "AUTO&Wirtschaft" durchgeführt hat.
Wenige Vorteile ...
Der staatlich verordnete Totalabschied von Benzin und Diesel werde zweifellos einen Beitrag zur Reduktion der Gesamtemissionen leisten, hält das von Univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber geleitete Wissenschaftlerteam fest. Angesichts der Tatsache, dass auch die Stromerzeugung CO 2 verursacht, stünden aber "im besten Fall etwa 5 bis 6 Prozent der gesamten Emissionen zur Disposition". Umgelegt auf die Kosten von CO 2-Zertifikaten, entspreche dies einem "zweistelligen Millionenbetrag" an Einsparungen. Positiv wäre für die Studienautoren zudem, dass durch die verringerte Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen eine "Verbesserung der Stabilität des Preisniveaus" erzielt werden könnte: Schließlich haben die Spritpreise wesentliche Auswirkungen auf die Inflationsrate.
und handfeste Nachteile
Dem gegenüber stehen laut der ISA-Studie zahlreiche negative Folgen -etwa die "schlagartige Entwertung" des rund um den Verbrennungsmotor aufgebauten Knowhows oder die weitere Zunahme der Landflucht, weil die reichweitenschwachen Elektroautos für dezentrale Siedlungsräume kaum geeignet sind. Hinzu kommendie Kosten für die Ladeinfrastruktur: Während Ende 2015 in Österreich weniger als 2.700 Ladepunkte verfügbar waren (darunter nur 87 Schnellladestellen), wären bei einer Umstellung des gesamten Pkw-Bestands selbst unter konservativen Annahmen mindestens 200.000 E-Zapfsäulen erforderlich. "Allein die Hardware in einer günstigen Variante würde Kosten von abgerundet 250 Millionen Euro verursachen", erklärt Haber. Dazu kämen noch Liegenschaftskosten, Errichtung, Wartung und Reparaturen sowie natürlich die Stromkosten.
"Von größter Relevanz für den Automobilsektor ist freilich, ob die nicht mehr verkauften konventionellen Autos insgesamt durch E-Autos substituiert werden oder ob es generell zu einem Rückgang der abgesetzten Menge in diesem Bereich kommt", sagt Haber. Zweiteres erscheint wahrscheinlicher, denn Elektroautos werden auch in einigen Jahren noch deutlich teurer als herkömmliche Fahrzeuge sein. Welche Folgen hätte dieser Marktrückgang für die heimische Volkswirtschaft?
Arbeitsplätze in Gefahr
Laut Statistik Austria kamen die Wirtschaftsbereiche "Kfz-Handel und -Reparatur" sowie "Herstellung von Kraftwagen und -teilen" 2015 gemeinsam auf einen Umsatz von knapp 43 Milliarden Euro. In rund 10.500 Unternehmen wurdenüber 110.000 Personen beschäftigt, der direkte Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt lag bei 6,6 Milliarden Euro. Dies entsprach etwa 3,2 Prozent aller unselbstständig Beschäftigten sowie 2 Prozent der gesamten österreichischen Wirtschaftsleistung. "Gesamtwirtschaftlich würden für jeden Euro Umsatzreduktion in der Produktion direkt 20 Cent, in vorgelagerten Branchen 18 Cent und durch Kaufkrafteffekte noch einmal etwa 10 Cent weniger an Wirtschaftsleistung resultieren", rechnet Haber vor. Im Bereich Handel und Reparatur wäre der Rückgang mit knapp 1,1 Euro sogar mehr als doppelt so hoch.
Und die Auswirkungen auf die Beschäftigtenzahl? "Eine Million Euro weniger Umsatz in der Produktion würde insgesamt 4,6 Arbeitsplätze kosten, ein entsprechender Umsatzrückgang im Bereich Handel und Reparatur sogar 7,3 Arbeitsplätze", so Haber.
Politischer Testballon
Das vom Umweltbundesamt vorgeschlagene Verkaufsverbot ist so radikal, dass man versucht sein könnte, es als Hirngespinst der Studienauftraggeber (Biomasseverband, IG Windkraft und ein Energieeffizienzdienstleister namens "Save Energy") abzutun. Doch das Umweltbundesamt ist ein staatseigenes Unternehmen: Als solches ist es nicht zuletzt dazu bestimmt, politische Testballons steigen zu lassen-ohne Gefahr für den zuständigen Minister, falls diese platzen sollten. Bevor die Politik ihre Verbotsüberlegungen weiterverfolgt, sollte sie sich freilich auch die ISA-Studie zu Gemüte führen: Sie zeigt, wie der durchaus berechtigte Traum von der emissionsfreien Mobilität bei allzu brachialen Methoden schnell zum Albtraum für die österreichische Volkswirtschaft werden kann.